
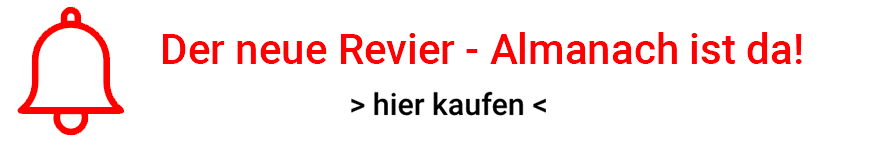
WVW 100 Jahre - und kein bisschen leise

Die Aufgaben sind vielfältig für den heutigen WVW, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert. Rund 120 Unternehmen aus Berlin und den östlichen Bundesländern sind Mitglied in dem Verband, der seit 2020 auch dem BVWW angehört. Die Tätigkeitsfelder für den Verband sind breit aufgestellt: Nachhaltigkeit in der Produktion, Infrastruktur von Häfen und Wasserrastplätzen, der Wassertourismus einer jungen Generation, Fachkräftemangel oder Digitalisierung – es gibt viel zu tun!
„Wassersport ist nicht elitär, er ist für fast jeden finanzierbar“, sagt Daniel Barkowski, 1. Vorsitzender des WVW. Als Projektleiter der Berliner BOOT & FUN ist er ganz nah an den Trends. „Auch die Messe ist jünger geworden“, spricht er von einem veränderten Publikum. „Vom Schlauchboot bis zur Yacht gehört alles dazu. Wassersport ist oft auch ohne Patent möglich.“ Barkowski betont zudem die Rolle der Region: „Berlin ist das Epizentrum des Wassersports!“ Mehr Seen und Kanäle als im Umkreis von Berlin gibt es im ganzen Land nirgends. Auf den weitläufigen Revieren um die Hauptstadt fahren unzählige Boote. Am Wassertourismuskonzept für Berlin mitzuarbeiten bezeichnet daher auch Ben Hoffmann, der im BVWW als Referent den WVW betreut, als Kernaufgabe der beiden Verbände. Es gelte, die Wertschöpfungskette darzustellen. „Wassersport zieht Touristen an, die Geld in die Region bringen“, blickt Hoffmann auf den wirtschaftlichen Aspekt.
Zwar ist der Drang der Menschen aufs Wasser ungebrochen, doch derzeit sieht sich die Branche einer gewissen Kaufzurückhaltung gegenüber. Dazu stehen viele, oft kleinere Firmen, vor einem ungeklärten Nachfolgeproblem. „Wir müssen aufpassen, dass keine Bootsstände verloren gehen“, mahnt Hoffmann. Mit dem Ende des Tagebaus in weiten Landstrichen und der Flutung vieler Braunkohlegruben wird dagegen die Reviervielfalt weiter zunehmen. „Wo geht die Reise hin, wie können wir erweitern, wie steht es um die Infrastruktur von Wasserrastplätzen“, fragt auch Frank Ringel, Schatzmeister des WVW und über 30 Jahre für den Verband aktiv. „Es sind sehr viel unterschiedliche Probleme, die gemeistert werden müssen.“ Das Auslaufen von Nutzungsverträgen mit den Wasserschifffahrtsämtern sieht Ringel für viele Betriebe als existenzbedrohend. Nicht neue Stege bauen, sondern vorhandene erweitern, weil dort ein großer Teil der Infrastruktur schon da ist, ist in seinen Augen vordringlich. „Der Wassersport muss auf den Tisch der Politik. Firmen brauchen Unterstützung, um zu investieren“, wünscht sich Daniel Barkowski klarere Rahmenbedingungen, auch eine Förderung von innovativen Ansätzen. Besonders deutlich wird dies beim Thema Elektrifizierung von Bootsantrieben. Boote mit E-Motor gibt es genug auf dem Markt. Aber wo fährt man damit hin? Denn Ladestationen am Wasser sind absolute Mangelware. Pläne und Konzepte brauchen Unterstützung, denn ohne konkret geplante Standorte gibt es weder eine Handlungsgrundlage noch eine Genehmigung, weiß Ringel von den komplexen Zusammenhängen. An der elektrischen Infrastruktur gibt es also – nicht nur im Berliner Raum – jede Menge Nachholbedarf. Aus Ben Hoffmanns Sicht ist auch die Digitalisierung, besonders bei den Schleusen und entsprechenden Informationen, ein großes Thema. Man dürfe die neue Generationen nicht vergessen – und deren Informationskanäle, die neuen Wegen folgen.
Klassisch auf Papier ist dagegen der Revier-Almanach, den der WVW jährlich herausgibt. Das Magazin informiert über die wichtigsten Themen rund um die Wassersportreviere im Osten: Revierbeschreibungen, Törntipps, Marinas und Gastronomie am Wasser, Werften und Servicebetriebe, Schleusenzeiten, Notfalladressen und ein Nachschlagewerk aller Verbandsbetriebe sowie eine amtliche Karte machen das Heft zum unverzichtbaren Begleiter auf dem Wasser. Inzwischen gibt es den Revierführer auch als PDF zum Download: www.revier-almanach.com.
Der WVW ist ideeller Träger der Wassersportmesse BOOT & FUN, die 2024 die vom 28. November bis zum 1. Dezember unter dem Berliner Funkturm stattfinden wird. Den Inwater-Ableger (30. August bis 1. September 2024 in der Marina Havelauen in Werder), gibt es seit 2018.
Ein weiteres Schlagwort in der Branche ist Fachkräftemangel. Natürlich ist Wassersport ein Saisongeschäft, in dieser Zeit gibt es viel zu arbeiten. „Es sind aber auch schöne Arbeitsplätze“, verweist Barkowski auf die Attraktivität der Arbeitsorte und „die Kraft des Wassers“.
Viele Themen im Raum Berlin sind also die gleichen wie im ganzen Land. Der Zusammenschluss der beiden Verbände war folglich richtig, hat beiden Seiten viel gebracht. Und wie anderswo auch hat der Wassersport immer eine regional sehr individuelle Note – das ist seine große Stärke, macht einen großen Teil seiner Anziehungskraft aus.
Stolz auf das Erreichte kann man bei der Jubiläumsfeier Ende August – standesgemäß auf dem Zernsee (nicht „am“ See) – durchaus sein. Anlass zum Netzwerkeln besteht mehr denn je. Und die Herausforderungen werden nicht weniger.
100 Jahre vorher - die Historie des WVW
Auf 100 Jahre Geschichte kann der WVW zurückblicken. 1924 schon wurde sein Vorläufer, der „Verband der Bootshausbesitzer“ in Charlottenburg gegründet. Nach wechselhafter Entwicklung wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg im Februar 1950 ein zweites Mal aus der Taufe gehoben – nunmehr als „Wirtschaftsverband Wassersport“. Er überdauerte vier Jahrzehnte im eingemauerten Westberlin und blühte nach der Wiedervereinigung erneut auf. Seit einigen Jahren ist der WVW wieder sehr aktiv.
Man schrieb das Jahr 1924. Der verlorene Erste Weltkrieg lag noch nicht lange zurück, die Weimarer Republik stöhnte unter den mit dem Versailler Friedensvertrag auferlegten Reparationszahlungen. Die Inflation – die damals nur Deutschland heimgesucht hatte – war gerade Ende 1923 mit der neuen Goldmark beendet. Die Preise für die Vermietung von Booten hatte man vorher noch an den Brotpreis gekoppelt, da sonst der Mietzins Stunden später bei Rückgabe des Bootes nichts mehr wert gewesen wäre. 250 Milliarden Reichsmark hatte man am Höhepunkt der Inflation für ein Pfund Zucker bezahlen müssen, ehe am 16. November 1923 die Rentenmark (auch Goldmark genannt) eingeführt wurde. Unter dem Eindruck dieser Geldentwertung hatten sich einige Bootshausbesitzer, wie die Bootsverleiher und Vermieter von Bootsunterständen damals genannt wurden, zunächst lose zusammengeschlossen.
Nach einem Sommer, in dem sich zumindest die währungspolitische Situation entspannt hatte, wurde der „Verband der Bootshausbesitzer“ gegründet, der am 8. September 1924 beim Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen wurde.
Die 1920er Jahren waren geprägt von politisch unruhigen Zeiten. Die Regierungen wechselten beinahe im Halbjahresrhythmus. Die „Goldenen Zwanziger“ waren eher heftige gesellschaftliche Veränderungen, allen voran die Emanzipation der Frauen auf allen Ebenen. Wirtschaftlich waren nur die Jahre 1926 bis 1929 (Beginn der Weltwirtschaftskrise) prosperierend. Aber: Sport wurde zu einem Massenvergnügen – und damit auch der Wassersport.
Schon nach wenigen Jahren zählte der Verband der Bootshausbesitzer (unter Geschäftsführung von Johannes Schiff) über 120 Mitglieder aus dem Großraum Berlin, berichtete die Jubiläumsschrift zum 75. Geburtstag des WVW anno 1999. Die Förderung des Wassersports sei Anliegen des Verbands gewesen. „Er kämpft gemeinsam mit den Wassersportverbänden gegen das Überhandnehmen von Zeltstädten an den Ufern und für die Erhaltung von Anlegeplätzen“, so der Rückblick. Aber auch die Disziplin auf dem Wasser war wohl schon ein Problem – denn der Verband gab ein „Merkblatt für den Wassersport“ (Auflage 25.000 Exemplare!) heraus. Die Ermittlung gestohlener Boote war eine weitere Aufgabe. Auch für die „Herabsetzung der zu hohen Eisenbahnfahrpreise zu den Wassersportzielen der Berliner Umgebung“ setzte sich der Verband ein, ebenso wie für die Beseitigung einer Motorbootsteuer und kämpfte gegen einen Nummernzwang für private Sportboote.

Bei allem Widerstand gegen Regulierungswünsche der Obrigkeit hängte der Verband offenbar sein Fähnchen nach dem Wind. Denn schon 1933 wurde er in den „Reichsverband der Bootshausbesitzer“ umgewandelt. Alfred Söhnel wurde 2. Vorsitzender. Der damals 37-Jährige hatte an der Ecke Griebnitzsee/Teltowkanal, ein Stückchen südlich vom Wannsee, eine Werft für Kanus. Die Werft stellte wohl erst Jahrzehnte später mit dem Aufkommen von Kunststoff als Bootsbaumaterial ihren Betrieb ein. Das Anwesen gibt es heute noch. Bootshütten dienen nach wie vor als „Liegeplätze“, die frühere Werft ist zum Event-Restaurant mit Biergarten geworden.
Welche Einfluss Verbände haben können, zeigt sich übrigens am Muttertag: Den hatte erstmals 1923 der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber eingeführt …
Zurück zum Reichsverband, der 1937 schon wieder (auf Anordnung der Nazi-Regierung) aufgelöst wurde und der Wirtschaftsgruppe „Gaststätten und Beherbergungsbetriebe, Dachabteilung Sportstätten“ eingegliedert wurde, die bis zum Kriegsende 1945 bestand.
Seit Anfang der 1930er Jahre existierte ein weiterer fachlicher Zusammenschluss in der Branche, den „Wassersport-Industrie- und Handelsverband“, der auch die Wassersport-Ausstellung in Berlin veranstaltete.
Im Krieg wurde eine Vielzahl der Boote in Berlin und Umgebung zerstört (der Rückblick anno 1999 ging von 90 Prozent aus), weitere wurden versenkt oder zerlegt und versteckt, um einer Beschlagnahme durch die Besatzungsmächte zu entgehen.
Neugründung 1950
Die wirtschaftlichen Zwänge der Nachkriegszeit brachten die beiden Verbände zusammen. Kaum war das Verbot von Vereinen durch die Alliierten aufgehoben, wurde mit dem Datum 20. Februar 1950 der „Wirtschaftsverband Wassersport e.V.“ ins Vereinsregister eingetragen. Alfred Söhnel wurde 1. Vorsitzender (bis 1972), Franz Ludwig sein Stellvertreter. Geschäftsführer wurde Johannes Schiff, wie schon in den 1920er Jahren. Erneut war der Verband maßgeblich an der Entwicklung einer Wassersport-Ausstellung in Berlin beteiligt. Schon im Gründungsjahr musste er sich gegen eine Sportbootsteuer wehren. Denn mit der Währungsreform („D-Mark“) im Westen tauchten viele Boote wieder auf.
1951 wurde das Merkblatt aus den 1920er Jahren erneut aufgelegt. Der Verband unterstütze einen Musterprozess, in dem sich ein Mitgliedsbetrieb bei Gericht erfolgreich dagegen wehrte, Schadensersatz für ein aus dem Bootshaus gestohlenes Boot zahlen zu müssen. In den Folgejahren werden Bestrebungen der Polizei, einen Motorbootführerschein einzuführen, abgewehrt und die nach dem Krieg eingeführte Registrierungspflicht für Sportboote dank den Bemühungen der Verbände wieder aufgehoben.
Vier Jahrzehnte war der neu gegründete WVW auf das eingemauerte Westberlin beschränkt. Er wehrte sich mehrfach (oft erfolgreich) gegen Bestrebungen, Steuern einzuführen, Gebühren auf das Mehrfache anzuheben oder Führerscheinpflichten einzuführen und Fahrverbote auszusprechen. Kaum ein Jahr verging, ohne dass der Verband nicht mit solchen Versuchen, den Wassersport einzuschränken oder zu verteuern, konfrontiert war.
Wiedervereinigung auf dem Wasser
Mit dem Fall der Mauer und der 1990 folgenden Wiedervereinigung änderte sich die Lage auf den Gewässern rund um Berlin erheblich. „Es gab mehr Boote für die Ossis, mehr Reviere für die Wessis. Da ist Deutschland auf dem Wasser zusammengewachsen“, erinnert sich Daniel Barkowski, Projektleiter der Berliner Messe „BOOT & FUN“ und seit 2020 der 1. Vorsitzende des WVW. Da habe die Wiedervereinigung zuerst geklappt, so Barkowski.
Ein Pendant zum WVW gab es in der DDR nicht. „Es gab im Osten kaum private Wassersportbetriebe“, erklärt Frank Ringel, selbst am Zernsee bei Werder an der Havel (Brandenburg) aufgewachsen. „Erst mit der Wiedervereinigung entstanden gewerbliche Betriebe, die dann in den WVW eingetreten sind, da es keine Innung oder ähnliches gab.“ Zur Orientierung wurde eine Broschüre „Wassersport in Berlin-Brandenburg“ herausgegeben, der Vorläufer des heutigen „Revier-Almanachs“. Großer Beliebtheit erfreuten sich übrigens die Verbandsreisen, die etwa zu den Zubehörmessen in Amsterdam, Chicago und Singapur führten! Die „Magdeboot“ wurde 1990 ins Leben gerufen, bei der auch der WVW im Messebeirat war, nachdem die lange Jahre vom WVW unterstützte Bootsmesse in Berlin zeitweilig eingestellt worden war.
Gut zehn Jahre nach der Wiedervereinigung gab es erste gemeinsame Aktionen zwischen dem WVW und dem BVWW, wie sich Frank Ringel erinnert: Im Jahr 2000 wurde die Charterschein-Regelung eingeführt, mit der Skipper nach einer Einweisung Hausboote auch ohne einen Sportbootführerschein lenken dürfen. 2002 wurde dann die BOOT & FUN vom WVW mit der Messe Berlin ins Leben gerufen. Zehn Jahre später war die Zahl der Aussteller schon auf über 600 angewachsen, voriges Jahr waren es sogar 850.

„Der WVW hat sich immer für moderate Wasserpachten eingesetzt“, führt Ringel ein weiteres Tätigkeitsfeld des Berliner Verbands an. Die Gebühren wurden nach guten, mittleren und schlechten Qualitäten der Wasserliegeplätze gestaffelt. „Vereine zahlen bis heute nur 50 Prozent davon“, so Frank Ringel weiter. Mit Rolf Bähr, dem Justiziar und Präsidenten des Deutschen Segler-Verbands, war man bis vors Bundesverwaltungsgericht gezogen.
In den 2010er Jahren näherten sich WVW und BVWW an. „Jürgen Tracht hat immer wieder einmal wegen einer Kooperation angefragt“, so Ringel. Eine Fusion indes war bei den Mitgliedern des WVW durchgefallen. BVWW-Justiziar Stefan W. Meyer arbeitete daraufhin einen Kooperationsvertrag zwischen beiden Verbänden aus, schildert Frank Ringel weiter. „Es musste ja was passieren. Zwei gleichartige Verbände machten keinen Sinn“, so Ringel. Auch Barkowski erinnert sich: „Es geht um den Wassersport in ganz Deutschland – lasst uns das gemeinsam voran treiben“, war seine Meinung. 2020 kam es dann zum Kooperationsvertrag, den der damalige 1. Vorsitzende Ingo Gersbeck, der in Berlin-Spandau eine Schiffsbunkerstation betreibt, unterzeichnete. „Zwei halbe Gläser sind ein ganzes – das war der richtige Weg“, so Barkowski. „Wir wollten mehr leisten – und mit der Geschäftsstelle in Köln können wir mehr leisten.“ Ben Hoffmann hat als neuer Referent im BVWW den Zusammenschluss von Anfang an betreut: „Das Gebiet ist einzigartig“, ist der in Stuttgart aufgewachsene Kölner begeistert von der Aufgabe, sich um die WVW-Mitglieder zu kümmern.
Wassersport Verband
1924
Noch war Friedrich Ebert Reichspräsident. Er löste Mitte Januar 1924 den Reichstag auf. Wilhelm Marx war Reichskanzler, er konnte nach der Neuwahl im Mai nur noch eine Minderheitsregierung bilden. Im Dezember wurde dann erneut gewählt. Die Rentenmark wurde von der Deutschen Reichsmark abgelöst. Adolf Hitler wurde als Drahtzieher des Putsches im Vorjahr zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, kam aber im Dezember schon wieder frei. In dieser Zeit hatte er „Mein Kampf“ geschrieben. Das Luftschiff LZ 126 (201 Meter lang, der erste Zeppelin mit Übernachtungskojen für Passagiere) wurde als Reparationszahlung in einer waghalsigen Fahrt von Hugo Eckener vom Bodensee nach New York geflogen. Der 1. FC Nürnberg wurde mit einem 2:0 gegen den Hamburger SV Deutscher Fußballmeister -– und eine kleine Brauerei im württembergischen Allgäu hatte das Kristallweizen erfunden.